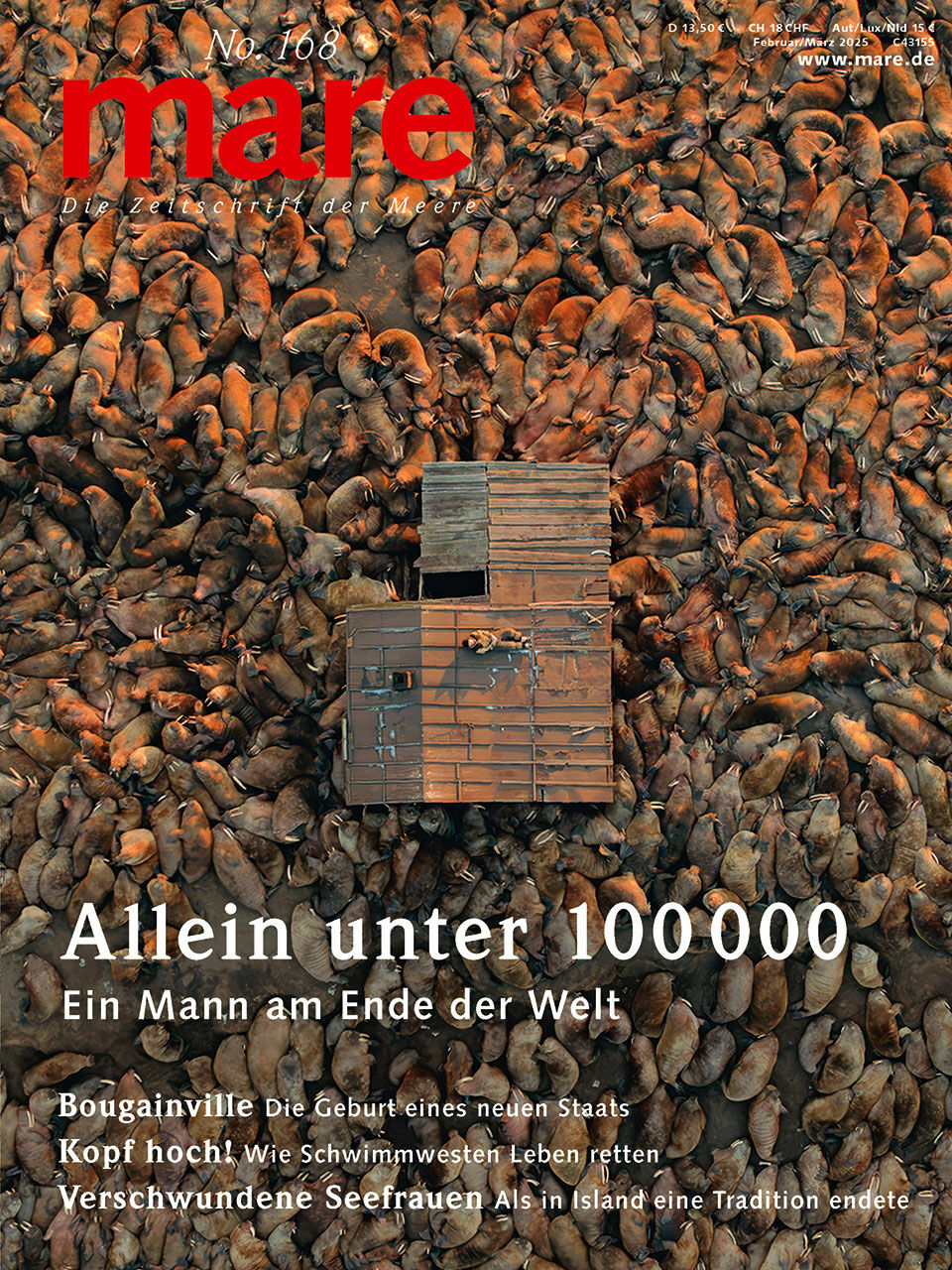Revolution im Schiffsbauch
Sie hat schon Steine gegen Grundschleppnetzfischerei in der Nord- und Ostsee versenkt, Mikroplastikproben im Rhein gesammelt und immer wieder mit Protestbannern zwischen den Masten gegen die Verschmutzung und Zerstörung der Natur demonstriert: die „Beluga II“ von Greenpeace, ein 33 Meter langer Plattbodensegler. „Wann immer möglich, segeln wir“, sagt Kapitän Uwe Linke beim Gang übers Schiff. „Aber wenn der Wind ungünstig steht oder wir unter Brücken die Masten einklappen müssen, dann geht es nicht ohne Motor.“
Im Sommer 2024 liegt die „Beluga II“ in der Schiffswerft Diedrich kurz vor der Emsmündung bei Emden. Ein großes Loch klafft im Boden des Steuerraums. „Um den alten Dieselmotor aus dem Maschinenraum zu bekommen“, erklärt Linke. Stattdessen wurden Schaltschränke eingebaut, ein Batterieblock, der überschüssigen Strom speichern und Lastspitzen abfedern soll, und Tanks für vier Tonnen grünes Methanol. Was noch fehlt, ist das Herzstück des neuen Elektroantriebs: die Brennstoffzellen. Damit soll die „Beluga II“ in Zukunft CO2-neutral unterwegs sein, als eines der ersten seetauglichen Schiffe überhaupt.
Der Schiffsverkehr auf Meeren und Binnengewässern produziert rund drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen, gut eine Milliarde Tonnen CO2, Methan und Lachgas im Jahr. Besonders Frachter und Kreuzfahrtschiffe mit Schweröl im Tank stoßen zudem Unmengen gesundheitsschädlicher Schwefeloxide, Stickoxide und Feinstaub aus. Strengere Umweltauflagen sollen den Druck auf den Sektor erhöhen, nachhaltiger zu werden – mit neuen Antriebstechnologien und alternativen Kraftstoffen. Seit 2024 etwa müssen große Schiffe, die EU-Häfen anlaufen, CO2-Zertifikate für einen Teil ihrer Emissionen erwerben. Klimaneutralität um 2050 hat die International Maritime Organization (IMO) als Ziel ausgegeben.
Brennstoffzellen gelten als eine Schlüsseltechnologie für die Dekarbonisierung der Schifffahrt. Sie wandeln chemische Energie aus der Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff zu Wasser in elektrische um, sauber und CO2-frei. Zugleich erlauben sie längere Reichweiten und kürzere Hafenliegezeiten als Batterieantriebe. Neben Wasserstoff, der aufgrund der Lagerung bei 700 Bar oder minus 253 Grad Celsius viel Platz beansprucht, eignen sich wasserstoffhaltige Verbindungen wie Ammoniak oder Methanol als Treibstoff. „Brennstoffzellen bieten zwei Vorteile gegenüber konventionellen Motoren“, sagt Syed Asif Ansar, Leiter der Abteilung Energiesystemintegration am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Stuttgart: „Sie erzeugen weniger Schadstoffe, und ihr höherer Wirkungsgrad senkt den Kraftstoffverbrauch.“
Ansar koordiniert ein EU-finanziertes Projekt, in dem Partner aus Wissenschaft und maritimer Industrie ein Brennstoffzellensystem für Kreuzfahrtschiffe entwickeln. Es soll Strom für den Antrieb und Hotelbetrieb an Bord liefern, die Abwärme könnte den Pool heizen. Im Oktober 2024 wurde auf dem Gelände der DLR ein Prototyp eingeweiht. Das System kann Flüssiggas, aber auch E-Fuels aus Ökostrom sowie Biokraftstoffe aus organischen Abfällen nutzen, was Umrüstungen erleichtern soll. „Allein dank ihrer Effizienz reduzieren die Brennstoffzellen den CO2-Ausstoß um gut 30 und Luftschadstoffe um 95 Prozent. Und das im Betrieb mit Erdgas“, so der Forscher. Mit E-Ammoniak oder Biomethanol statt fossilen Energieträgern könnten die Schiffe praktisch emissionsfrei angetrieben werden. Weil sie leise und vibrationsarm laufen, versprechen sie dazu mehr Komfort für Kreuzfahrttouristen und weniger Lärm für Meeresbewohner.
Bis zum serienreifen Einsatz von Brennstoffzellen auf Schiffen ist noch viel Entwicklungsarbeit nötig. Auch die Infrastruktur, etwa um grüne Treibstoffe zu bunkern, fehlt bislang. Doch Staaten wie Deutschland und Norwegen treiben die Technologie voran. Erste Wasserfahrzeuge, teils mit hybrider Energieversorgung durch Brennstoffzellen und Batterien oder Gasmotoren, werden bereits in der Praxis erprobt. Zum Beispiel das Schubboot „Elektra“ mit Heimathafen Berlin, der Luxuskreuzer „Silver Nova“ aus der Papenburger Meyer-Werft oder die norwegische Autofähre „Hydra“.
In Deutschland werden solche Pilotprojekte von der Nationalen Organisation Wasserstoff- und Brennstoffzellentechnologie (NOW) koordiniert, einer bundeseigenen GmbH im Bereich nachhaltige Mobilität und Energieversorgung. Sie bringt Werften, Reedereien, Brennstoffzellenhersteller und Forschungsinstitute zusammen. „Aufgrund der Klimaziele der EU und der Vorgaben der IMO ist eine Dekarbonisierung des Schiffsverkehrs alternativlos, und das Interesse der Branche, ihre CO2-Emissionen zu verringern, ist groß“, sagt Katja Leuteritz, Wirtschaftsingenieurin und Teamleiterin Maritime Anwendungen bei der NOW. Bisher verläuft die grüne Wende auf dem Wasser äußerst schleppend. Ein Grund sei die lange Lebensdauer von Schiffen, oft fahren sie 30 Jahre oder mehr. Zudem kosteten klimafreundliche Umrüstungen – sofern überhaupt möglich – viel Zeit und Geld, so die Expertin.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 168. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Tim Kalvelage, Jahrgang 1984, promovierter Biogeochemiker und freier Wissenschaftsjournalist in Bremen, ist regelmäßig auf Flüssen und Seen unterwegs, fährt aber immer emissionsfrei – mit Paddel und seinem Faltboot „Orinoco“.
| Lieferstatus | Lieferbar |
|---|---|
| Vita | Tim Kalvelage, Jahrgang 1984, promovierter Biogeochemiker und freier Wissenschaftsjournalist in Bremen, ist regelmäßig auf Flüssen und Seen unterwegs, fährt aber immer emissionsfrei – mit Paddel und seinem Faltboot „Orinoco“. |
| Person | Von Tim Kalvelage |
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Vita | Tim Kalvelage, Jahrgang 1984, promovierter Biogeochemiker und freier Wissenschaftsjournalist in Bremen, ist regelmäßig auf Flüssen und Seen unterwegs, fährt aber immer emissionsfrei – mit Paddel und seinem Faltboot „Orinoco“. |
| Person | Von Tim Kalvelage |