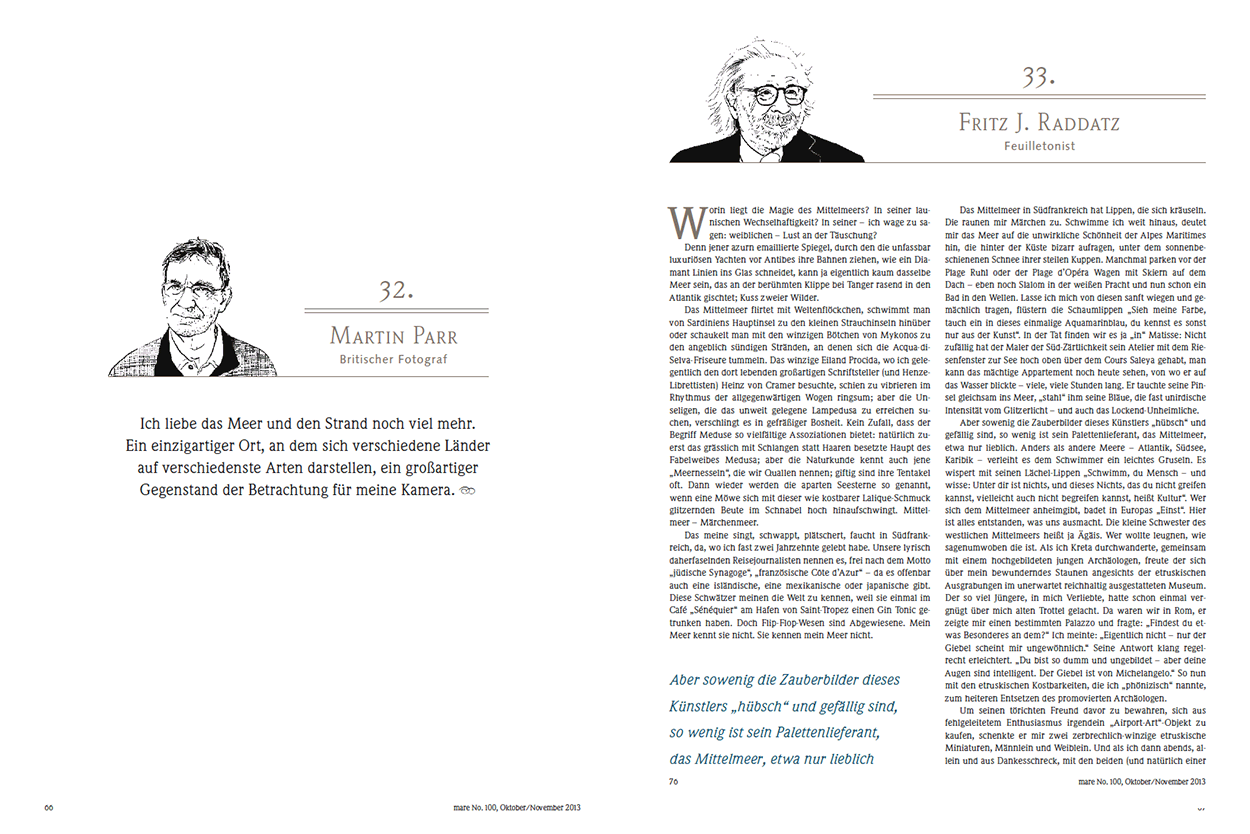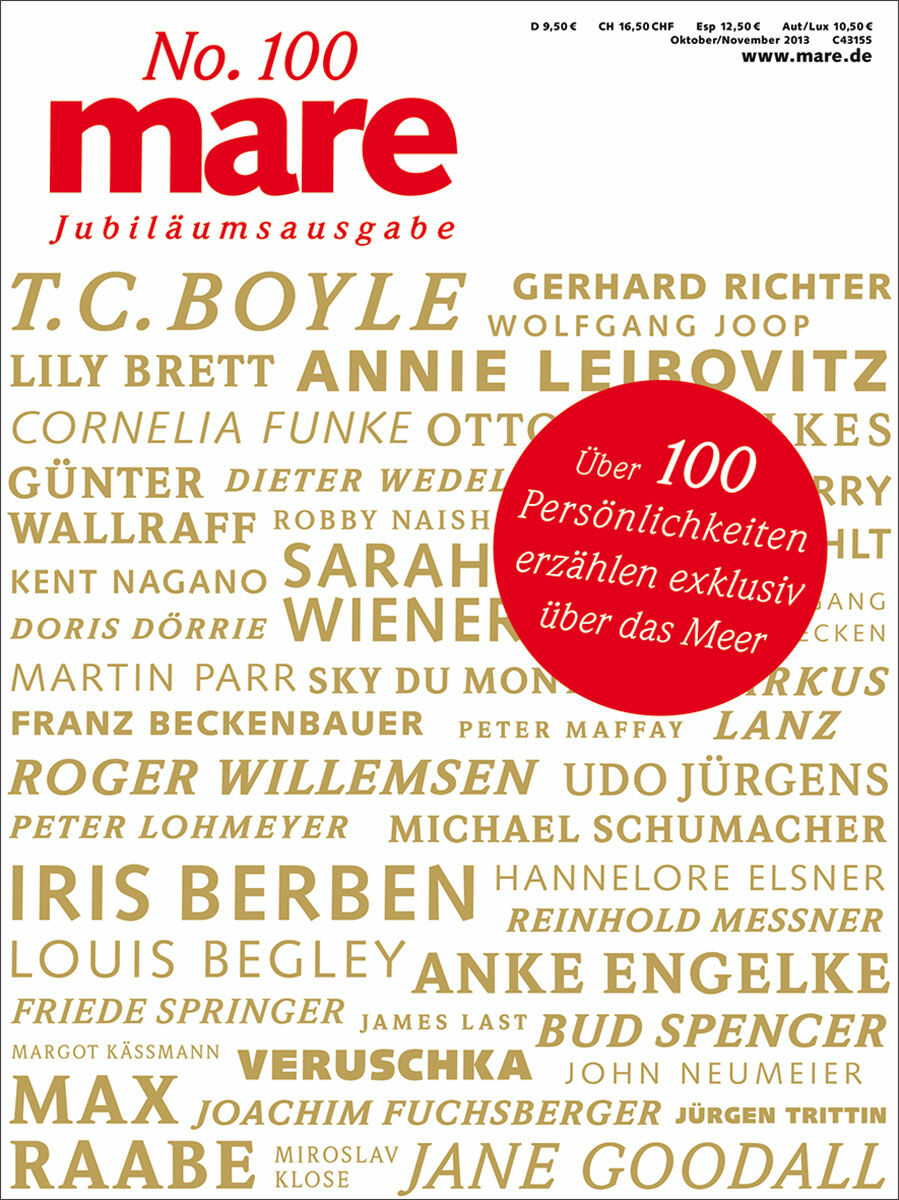Martin Parr, Fritz J. Raddatz, Anke Engelke, Roger Willemsen, Jane Goodall
MARTIN PARR
Britischer Fotograf
Ich liebe das Meer und den Strand noch viel mehr. Ein einzigartiger Ort, an dem sich verschiedene Länder auf verschiedenste Arten darstellen, ein großartiger Gegenstand der Betrachtung für meine Kamera.
FRITZ J. RADDATZ
Feuilletonist
Worin liegt die Magie des Mittelmeers? In seiner launischen Wechselhaftigkeit? In seiner – ich wage zu sagen: weiblichen – Lust an der Täuschung?
Denn jener azurn emaillierte Spiegel, durch den die unfassbar luxuriösen Yachten vor Antibes ihre Bahnen ziehen, wie ein Diamant Linien ins Glas schneidet, kann ja eigentlich kaum dasselbe Meer sein, das an der berühmten Klippe bei Tanger rasend in den Atlantik gischtet; Kuss zweier Wilder.
Das Mittelmeer flirtet mit Weltenflöckchen, schwimmt man von Sardiniens Hauptinsel zu den kleinen Strauchinseln hinüber oder schaukelt man mit den winzigen Bötchen von Mykonos zu den angeblich sündigen Stränden, an denen sich die Acqua-di-Selva-Friseure tummeln. Das winzige Eiland Procida, wo ich gelegentlich den dort lebenden großartigen Schriftsteller (und Henze-Librettisten) Heinz von Cramer besuchte, schien zu vibrieren im Rhythmus der allgegenwärtigen Wogen ringsum; aber die Unseligen, die das unweit gelegene Lampedusa zu erreichen suchen, verschlingt es in gefräßiger Bosheit. Kein Zufall, dass der Begriff Meduse so vielfältige Assoziationen bietet: natürlich zuerst das grässlich mit Schlangen statt Haaren besetzte Haupt des Fabelweibes Medusa; aber die Naturkunde kennt auch jene „Meernesseln“, die wir Quallen nennen; giftig sind ihre Tentakel oft. Dann wieder werden die aparten Seesterne so genannt, wenn eine Möwe sich mit dieser wie kostbarer Lalique-Schmuck glitzernden Beute im Schnabel hoch hinaufschwingt. Mittelmeer – Märchenmeer.
Das meine singt, schwappt, plätschert, faucht in Südfrankreich, da, wo ich fast zwei Jahrzehnte gelebt habe. Unsere lyrisch daherfaselnden Reisejournalisten nennen es, frei nach dem Motto „jüdische Synagoge“, „französische Côte d’Azur“ – da es offenbar auch eine isländische, eine mexikanische oder japanische gibt. Diese Schwätzer meinen die Welt zu kennen, weil sie einmal im Café „Sénéquier“ am Hafen von Saint-Tropez einen Gin Tonic getrunken haben. Doch Flip-Flop-Wesen sind Abgewiesene. Mein Meer kennt sie nicht. Sie kennen mein Meer nicht.
Das Mittelmeer in Südfrankreich hat Lippen, die sich kräuseln. Die raunen mir Märchen zu.
Schwimme ich weit hinaus, deutet mir das Meer auf die unwirkliche Schönheit der Alpes Maritimes hin, die hinter der Küste bizarr aufragen, unter dem sonnenbeschienenen Schnee ihrer steilen Kuppen. Manchmal parken vor der Plage Ruhl oder der Plage d’Opéra Wagen mit Skiern auf dem Dach – eben noch Slalom in der weißen Pracht und nun schon ein Bad in den Wellen. Lasse ich mich von diesen sanft wiegen und gemächlich tragen, flüstern die Schaumlippen „Sieh meine Farbe, tauch ein in dieses einmalige Aquamarinblau, du kennst es sonst nur aus der Kunst“. In der Tat finden wir es ja „in“ Matisse: Nicht zufällig hat der Maler der Süd-Zärtlichkeit sein Atelier mit dem Riesenfenster zur See hoch oben über dem Cours Saleya gehabt, man kann das mächtige Appartement noch heute sehen, von wo er auf das Wasser blickte – viele, viele Stunden lang. Er tauchte seine Pinsel gleichsam ins Meer, „stahl“ ihm seine Bläue, die fast unirdische Intensität vom Glitzerlicht – und auch das Lockend-Unheimliche.
Aber sowenig die Zauberbilder dieses Künstlers „hübsch“ und gefällig sind, so wenig ist sein Palettenlieferant, das Mittelmeer, etwa nur lieblich. Anders als andere Meere – Atlantik, Südsee, Karibik – verleiht es dem Schwimmer ein leichtes Gruseln. Es wispert mit seinen Lächel-Lippen „Schwimm, du Mensch – und wisse: Unter dir ist nichts, und dieses Nichts, das du nicht greifen kannst, vielleicht auch nicht begreifen kannst, heißt Kultur“. Wer sich dem Mittelmeer anheimgibt, badet in Europas „Einst“. Hier ist alles entstanden, was uns ausmacht. Die kleine Schwester des westlichen Mittelmeers heißt ja Ägäis. Wer wollte leugnen, wie sagenumwoben die ist. Als ich Kreta durchwanderte, gemeinsam mit einem hochgebildeten jungen Archäologen, freute der sich über mein bewunderndes Staunen angesichts der etruskischen Ausgrabungen im unerwartet reichhaltig ausgestatteten Museum. Der so viel Jüngere, in mich Verliebte, hatte schon einmal vergnügt über mich alten Trottel gelacht. Da waren wir in Rom, er zeigte mir einen bestimmten Palazzo und fragte: „Findest du etwas Besonderes an dem?“ Ich meinte: „Eigentlich nicht – nur der Giebel scheint mir ungewöhnlich.“ Seine Antwort klang regelrecht erleichtert. „Du bist so dumm und ungebildet – aber deine Augen sind intelligent. Der Giebel ist von Michelangelo.“ So nun mit den etruskischen Kostbarkeiten, die ich „phönizisch“ nannte, zum heiteren Entsetzen des promovierten Archäologen.
Um seinen törichten Freund davor zu bewahren, sich aus fehlgeleitetem Enthusiasmus irgendein „Airport-Art“-Objekt zu kaufen, schenkte er mir zwei zerbrechlich-winzige etruskische Miniaturen, Männlein und Weiblein. Und als ich dann abends, allein und aus Dankesschreck, mit den beiden (und natürlich einer Flasche Wein) am Dämmerstrand saß, bewegten sich die kleinen Tonmünder und erzählten mir: vom Meer, von ihrer – also unserer – Vergangenheit.
Aber nicht nur. Sie raunten mir vom Einst und vom Dereinst. Kleine Mittelmeergötter. Und je dunkler der einsame Abend herniedersank, desto mehr hörte ich von Herrschern, von Krieg, vom Handel über dem Meer, von Wollust und von Niedergangstrauer. Es war die große Mittelmeer-Saga, die ich erlebte. Und ich bekomme Ideen und gebe ihnen nach, tue etwas Seltsames, auch Unerlaubtes: Ich habe eine Badekappe dabei, stülpe sie über, stecke behutsam Monsieur und Madame Etrusker unter den Rand, klemme sie mir rechts und links hinters Ohr – und schwimme mit ihnen in die Nacht hinaus. Ich will sie in ihrem Ursprungselement körperlich spüren. Ihre kleinen Tonkörperchen und nur für mich hörbaren Stimmchen sollen mir das Mysterium meines Mittelmeers erklären. Nass, erschöpft und frierend hocke ich später am nächtlichen Strand, streichle meine nun stummen Ciceroni – und muss plötzlich lachen, fast wie befreit. Aber noch immer hakt mein Unbildungsirrtum in mir. Mir fällt ein Satz meines Freundes Joachim Kaiser ein, den er gerne bei zu niedrigen Honorarangeboten benutzte: „Ja, ja – man weiß ja, dass die Phönizier das Geld erfunden haben; aber warum so wenig davon?“ Die Welt hat mich wieder.
Das Mittelmeer auch, das immerhin auf fröhliche Weise weltlich ist. Es ist eben nicht immer nur die Kunst, die aus dem Licht gefischt wird, etwa die manieristischen Keramikfiguren Picassos, die so zahlreich in dem hoch über der See aufragenden „Musée Picasso“ in Antibes von der Sonne geformt zu sein scheinen. Es sind auch keineswegs meine großen Kollegen, deren opulentes Riesentintenfass das azurne Wasser war – Tomasi di Lampedusa in der Bucht von Palermo; Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo oder Maurice Maeterlinck in seinem palastartigen (und jetzt verschandelten) Anwesen am Rande von Nizza, so rauschhaft, so großartig wie sein „Pelléas et Mélisande“, das ihn berühmt und reich machte. Nein, ganz weltlich-real, ganz säkular kann auch die Musik des Meeres an Südfrankreichs Gestaden sein.
Dem Spaziergänger auf der gewundenen Promenade von Cap-d’Ail winken hochmütig die herrschaftlichen Gründerzeitvillen zu, die sich – hoch oben auf den Klippen errichtet – einst die Garbo und Churchill, Marlene und Sacha Guitry, Maria Callas und Charlie Chaplin zu ihrem Adlerhorst erkoren hatten; immer versteckt zwischen den Wipfeln zaubrischer Gärten, mal von Palmen gesäumt, mal verborgen hinter blühendem Hibiskusgebüsch und mal geschützt von jenen Naturpalisaden aus meterhohen Agaven, in deren dickfleischige Blattschwerter jungverliebte Touristen aus Oslo, Bochum oder Liverpool ihre berühmten Herzen mit dem Amorpfeil eingeschnitten haben. Vergänglichkeit ist ihnen wohl noch fremd – sie wissen vermutlich nicht, dass die phallusähnlichen, stramm aufragenden, von Schmetterlingen umgaukelten Blüten den Namen „Tod“ tragen: Eine Agave stirbt, hat sie einmal geblüht. Noch sind es kleine plustrige Leuchttürme, die hinausblinken auf die spiegelnde Quecksilberscheibe des Meeres; sie scheint zu locken: „Komm, schöne Maid, ich halte dich.“
Das allerdings sollten Maid wie Knappe füglich meiden. Versuchung macht leichtsinnig und ist meist trügerisch. Gerade an diesen felsgesäumten Buchten tönt das Meer nur allzu oft „Hier herrsche ich“, es donnert heran mit einer tosenden Kraft, die ein argloser Schwimmer vor einer Sekunde noch nicht für möglich gehalten hätte. Das Mittelmeer ist kein Postkartenteich. Besonders eigenartig zu beobachten ist das für jeden, der den prächtig sich um die Halbinsel Cap Ferrat windenden Steinweg bezwingen will. Ein kleines Abenteuer. Zum einen, weil dies – man sagt, es sei die teuerste Gegend von ganz Frankreich – ein Spaziergang entlang des puren Goldes ist: mal charmante, mal protzige, mal unsichtbare Anwesen, versteckt in ihren weitläufigen Parkanlagen. Wer sich nicht auskennt, wundert sich anfangs über die vielen kleinen „U-Boot-Bunker“ unterhalb des Weges – das sind die in den Fels gehauenen Parkplätze der kleineren und größeren Motoryachten der Happy Few. Erst seit Mitterrands Erlass nämlich, dass es keine Privatstrände mehr geben darf, also auch die Gärten und Parks der Scheichs, Könige und Oligarchen auf ihren nicht öffentlichen Zugang zum Meer verzichten mussten, haben die Erfindungs-Reichen diesen Ausweg geschaffen: Von ihren Besitzungen gibt es nun unterirdischen Zugang – beschildert „privé“ – zur eigenen Badebucht, der eigenen kleinen Insel oder eben zu jenen Wassergaragen, aus denen sie im 007-Stil mit ihren Yachten oder Schnellbooten hervorschießen. Allerdings: wenn’s möglich ist. Denn gerade hier ist die Brandung meist so stark, dass Madame, die mit ihrem Wasser-Maserati nach „Monte“ zum Einkaufen preschen wollte, doch lieber den zuckelnden Bentley wählt. So hat diese Promenade – manchmal auch findig überbrückt, der Plebs muss drunter durch – etwas durchaus Kintopp- haftes. Links unten gurgelt das Meer, das sich nicht beherrschen lässt, rechts oben, auf den begrünten Hängen, die auch schon mal mit einem langen Privatlift zugänglich resp. unzugänglich gemachten Fabelschlösser derer, die uns beherrschen.
...
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 100. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Martin Parr (Jahrgang 1952) ist der radikalste Porträtfotograf. Keiner entlarvt so gekonnt wie der Brite, keiner hält uns unsere eigene Lächerlichkeit so schonungslos vor. Dicke Frauen in zu engen Kleidern, sonnenverbrannte Urlauber an zugemüllten Stränden, Schiefe-Turm-von-Pisa-Halter. Im Interview mit der „Zeit“ sagte er: „Es gibt viele Kollegen, die es in den Krieg zieht. Mich aber zieht es in den Supermarkt um die Ecke.“
Fritz J. Raddatz (Jahrgang 1931) besaß 20 Jahre lang eine Wohnung in Nizza, kennt seither das Leben am Mittelmeer und liebt die Côte d’Azur. Er ist einer der passioniertesten Feuilletonisten und Literaturkritiker unserer Zeit. Sein Weg führte unter anderem vom Cheflektorat bei Volk und Welt in Ost-Berlin zum stellvertretenden Leiter des Rowohlt-Verlags und Feuilletonchef der „Zeit“. Seine erzählerischen Arbeiten sind in vielen Auflagen und Übersetzungen erschienen.
Anke Engelke (Jahrgang 1965) gehört zu den klügsten und lustigsten Köpfen im deutschen Fernsehen. Ihre Sketche bei „Ladykracher“, in denen sie die verschiedensten Frauencharaktere spielt, sind ebenso legendär wie ihre souveräne dreisprachige Moderation des Eurovision Song Contest (ESC) 2011 in Düsseldorf.
Roger Willemsen (Jahrgang 1955-2016) begann seine Fernsehkarriere 1991 beim Bezahlsender Premiere. Für seine dort ausgestrahlte Interviewreihe „0137“ erhielt der gebürtige Bonner den Adolf-Grimme- Preis in Gold. Von 1994 bis 1998 moderierte er im ZDF die Sendung „Willemsens Woche“, die regelmäßig über eine Million Fernsehzuschauer vor den Bildschirm lockte. Im Jahr 2002 löste er alle seine Fernsehverträge und kündigte an, sich aus dem Medium „bis auf Weiteres“ zurückzuziehen. Seitdem konzentrierte sich der promovierte Germanist wieder auf seine literarischen Arbeiten.
Jane Goodall (Jahrgang 1934) wuchs in einfachen Verhältnissen in England auf. Ende der 1950er Jahre erfüllte sie sich ihren Lebenstraum und reiste nach Afrika, in Tansania begann sie 1960 das Verhalten von Schimpansen zu beobachten. 1965 promovierte sie an der Universität Cambridge ohne vorhergehendes Studium mit einer Ausnahmegenehmigung, 1977 gründete sie das Jane Goodall Institute for Wildlife Research, das Büros in 22 Ländern unterhält (www.janegoodall.de).
| Vita | Martin Parr (Jahrgang 1952) ist der radikalste Porträtfotograf. Keiner entlarvt so gekonnt wie der Brite, keiner hält uns unsere eigene Lächerlichkeit so schonungslos vor. Dicke Frauen in zu engen Kleidern, sonnenverbrannte Urlauber an zugemüllten Stränden, Schiefe-Turm-von-Pisa-Halter. Im Interview mit der „Zeit“ sagte er: „Es gibt viele Kollegen, die es in den Krieg zieht. Mich aber zieht es in den Supermarkt um die Ecke.“ Fritz J. Raddatz (Jahrgang 1931) besaß 20 Jahre lang eine Wohnung in Nizza, kennt seither das Leben am Mittelmeer und liebt die Côte d’Azur. Er ist einer der passioniertesten Feuilletonisten und Literaturkritiker unserer Zeit. Sein Weg führte unter anderem vom Cheflektorat bei Volk und Welt in Ost-Berlin zum stellvertretenden Leiter des Rowohlt-Verlags und Feuilletonchef der „Zeit“. Seine erzählerischen Arbeiten sind in vielen Auflagen und Übersetzungen erschienen. Anke Engelke (Jahrgang 1965) gehört zu den klügsten und lustigsten Köpfen im deutschen Fernsehen. Ihre Sketche bei „Ladykracher“, in denen sie die verschiedensten Frauencharaktere spielt, sind ebenso legendär wie ihre souveräne dreisprachige Moderation des Eurovision Song Contest (ESC) 2011 in Düsseldorf. Roger Willemsen (Jahrgang 1955-2016) begann seine Fernsehkarriere 1991 beim Bezahlsender Premiere. Für seine dort ausgestrahlte Interviewreihe „0137“ erhielt der gebürtige Bonner den Adolf-Grimme- Preis in Gold. Von 1994 bis 1998 moderierte er im ZDF die Sendung „Willemsens Woche“, die regelmäßig über eine Million Fernsehzuschauer vor den Bildschirm lockte. Im Jahr 2002 löste er alle seine Fernsehverträge und kündigte an, sich aus dem Medium „bis auf Weiteres“ zurückzuziehen. Seitdem konzentrierte sich der promovierte Germanist wieder auf seine literarischen Arbeiten. Jane Goodall (Jahrgang 1934) wuchs in einfachen Verhältnissen in England auf. Ende der 1950er Jahre erfüllte sie sich ihren Lebenstraum und reiste nach Afrika, in Tansania begann sie 1960 das Verhalten von Schimpansen zu beobachten. 1965 promovierte sie an der Universität Cambridge ohne vorhergehendes Studium mit einer Ausnahmegenehmigung, 1977 gründete sie das Jane Goodall Institute for Wildlife Research, das Büros in 22 Ländern unterhält (www.janegoodall.de). |
|---|---|
| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |
| Vita | Martin Parr (Jahrgang 1952) ist der radikalste Porträtfotograf. Keiner entlarvt so gekonnt wie der Brite, keiner hält uns unsere eigene Lächerlichkeit so schonungslos vor. Dicke Frauen in zu engen Kleidern, sonnenverbrannte Urlauber an zugemüllten Stränden, Schiefe-Turm-von-Pisa-Halter. Im Interview mit der „Zeit“ sagte er: „Es gibt viele Kollegen, die es in den Krieg zieht. Mich aber zieht es in den Supermarkt um die Ecke.“ Fritz J. Raddatz (Jahrgang 1931) besaß 20 Jahre lang eine Wohnung in Nizza, kennt seither das Leben am Mittelmeer und liebt die Côte d’Azur. Er ist einer der passioniertesten Feuilletonisten und Literaturkritiker unserer Zeit. Sein Weg führte unter anderem vom Cheflektorat bei Volk und Welt in Ost-Berlin zum stellvertretenden Leiter des Rowohlt-Verlags und Feuilletonchef der „Zeit“. Seine erzählerischen Arbeiten sind in vielen Auflagen und Übersetzungen erschienen. Anke Engelke (Jahrgang 1965) gehört zu den klügsten und lustigsten Köpfen im deutschen Fernsehen. Ihre Sketche bei „Ladykracher“, in denen sie die verschiedensten Frauencharaktere spielt, sind ebenso legendär wie ihre souveräne dreisprachige Moderation des Eurovision Song Contest (ESC) 2011 in Düsseldorf. Roger Willemsen (Jahrgang 1955-2016) begann seine Fernsehkarriere 1991 beim Bezahlsender Premiere. Für seine dort ausgestrahlte Interviewreihe „0137“ erhielt der gebürtige Bonner den Adolf-Grimme- Preis in Gold. Von 1994 bis 1998 moderierte er im ZDF die Sendung „Willemsens Woche“, die regelmäßig über eine Million Fernsehzuschauer vor den Bildschirm lockte. Im Jahr 2002 löste er alle seine Fernsehverträge und kündigte an, sich aus dem Medium „bis auf Weiteres“ zurückzuziehen. Seitdem konzentrierte sich der promovierte Germanist wieder auf seine literarischen Arbeiten. Jane Goodall (Jahrgang 1934) wuchs in einfachen Verhältnissen in England auf. Ende der 1950er Jahre erfüllte sie sich ihren Lebenstraum und reiste nach Afrika, in Tansania begann sie 1960 das Verhalten von Schimpansen zu beobachten. 1965 promovierte sie an der Universität Cambridge ohne vorhergehendes Studium mit einer Ausnahmegenehmigung, 1977 gründete sie das Jane Goodall Institute for Wildlife Research, das Büros in 22 Ländern unterhält (www.janegoodall.de). |
| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |