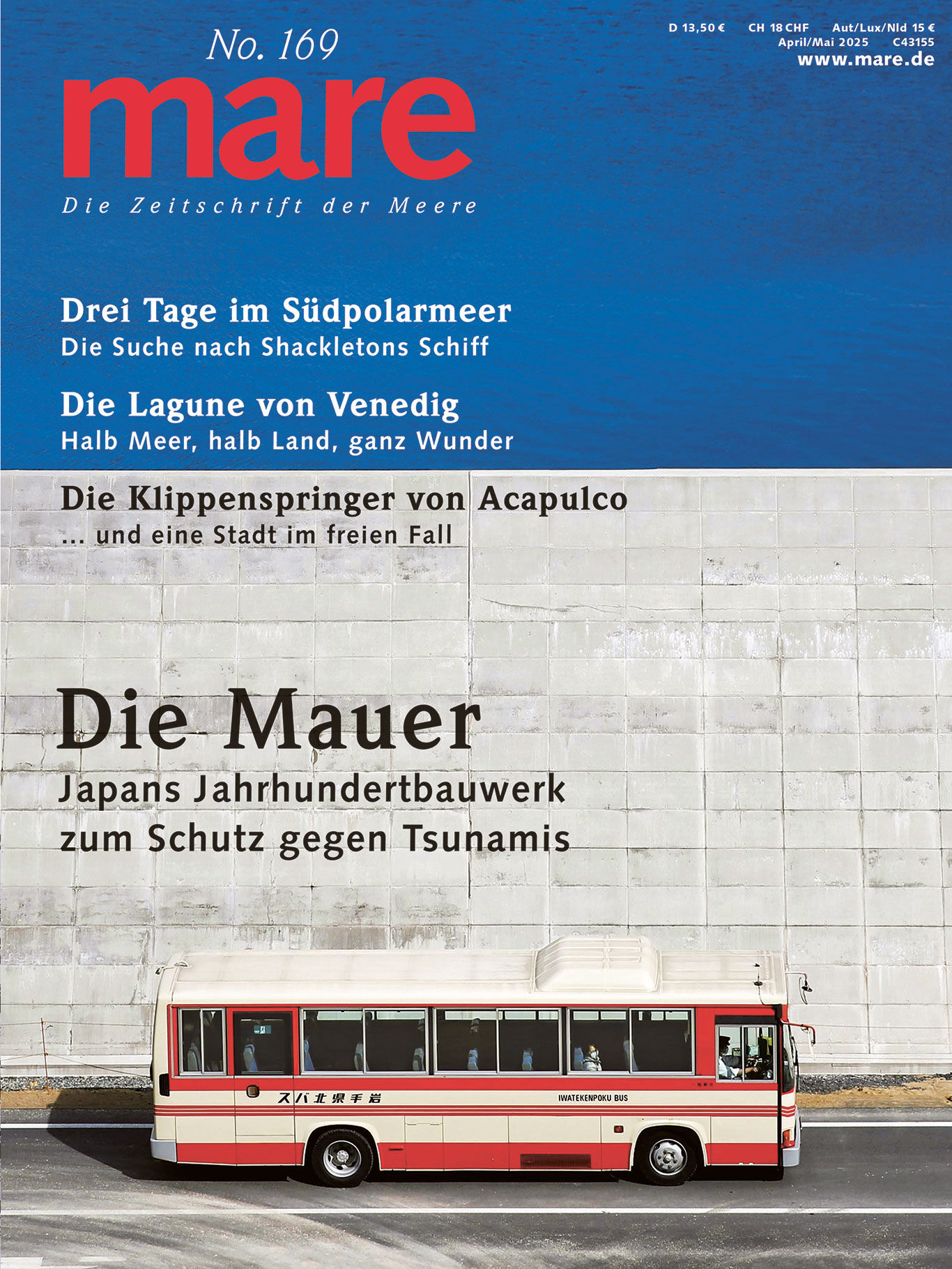Ein fast vergessener Freund
Der Posten gab noch einen Warnschuss ab, aber da standen die Männer auch schon vor ihnen, und den Engländern blieb nichts anderes übrig, als Frauen und Kinder zum Beten in die Häuser zu schicken. Fast 100 Krieger hatten sich auf dem freien Platz zwischen den Holzbauten versammelt, die Mienen reglos, die Gesichter rot bemalt. Ganz vorn stand ein hochgewachsener Mann, der Macht und Autorität ausstrahlte. Massasoit war der politische und geistige Führer, der Sachem der Wampanoag, deren Name „Volk des ersten Lichts“ bedeutete. Trotzdem ergriff nicht er jetzt das Wort, sondern ein Mann aus der zweiten Reihe. Der begrüßte die fremden Weißen, erkundigte sich nach ihrem Befinden und stellte sich vor: Sein Name sei Tisquantum, er gehöre zum Volk der Patuxet. Die Engländer sahen sich ungläubig an, einige bekreuzigten sich. Sie hatten jedes Wort verstanden. Der Krieger hatte fließend Englisch gesprochen. Es war der 22. März 1621, die Pilgerväter der „Mayflower“ waren soeben gerettet worden.
Geschichte verdichtet sich manchmal in wenigen Augenblicken, eine ganze Epoche entscheidet sich dann innerhalb eines kurzen Moments. Erkennbar ist dieser aber nur in der Rückschau. Und meist ist er historisch nicht belastbar. Denn natürlich kann man lediglich darüber spekulieren, was gewesen wäre, wenn einer der Wampanoag an diesem Morgen eines der Holzhäuser der Pilgrim Fathers betreten hätte, aus denen die angstvollen Gebete der Frauen zu hören waren. Oder wenn einem der ausgemergelten Engländer die Nerven durchgegangen wären.
Die „Mayflower“ war im November zuvor an der Küste Neuenglands vor Anker gegangen, die folgenden Wintermonate hatte nur die Hälfte ihrer Passagiere überlebt. Und jetzt tauchte da plötzlich ein Einheimischer auf, der Englisch sprach! Der ihre Fragen beantworten, der ihnen diese fremde Welt erklären konnte!
Auch mit 400 Jahren Abstand kann man nicht mit Sicherheit sagen, wie die Geschichte der Eroberung Nordamerikas verlaufen wäre, hätte es dieses Treffen nicht gegeben. Fest aber steht, dass das Überleben der jungen Plymouth Colony die englische Einwanderungswelle der folgenden Jahrzehnte und Jahrhunderte auslöste. Und dass sie in diesem Märzmorgen zumindest nicht verhindert wurde.
Schon etliche Jahrzehnte vor 1621 fischten englische Boote in den Gewässern vor der Ostküste Amerikas, und bei ihren gelegentlichen Treffen mit den Besatzungen dieser Trawler hatten Pennacook, Mohegan und Pequot immer wieder ein paar Floskeln aufgeschnappt. Noch wenige Tage zuvor war ein Mann ins Lager der Pilgrims gekommen, der sie mit „Willkommen, Engländer!“ begrüßt hatte, allerdings offenbar kein weiteres Wort ihrer Sprache beherrschte. Tisquantums Englisch aber war fließend. Den Pilgervätern fiel sogar auf, dass er mit Londoner Akzent sprach. Als sie ihn darauf ansprachen, nickte der Patuxet. Er kenne die Stadt gut, sagte er. Sehr gut sogar.
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts wurde der Atlantik zunehmend zum Binnenmeer zwischen Europa und Nordamerika. Englische Fischer stachen pünktlich zur Kabeljausaison in See, Auswanderer suchten ihr Glück in der Neuen Welt, Unternehmer verdienten an Biberpelzen.
1614 erhielt ein Lieutenant namens Thomas Hunt den Auftrag, an Neuenglands Küste getrockneten Fisch zu laden. In der Cape Cod Bay lud er Dorfbewohner auf sein Schiff ein – und entführte 19 von ihnen, um sie in Europa als Sklaven zu verkaufen, darunter: Tisquantum.
Hunt hinterließ keine Aufzeichnungen über seine menschliche Fracht. Bekannt ist seine Tat nur, weil der Verkauf scheiterte: In Málaga wollten aufgebrachte katholische Mönche die Auktion verhindern. Die spanische Kirche lehnte die Versklavung indigener Amerikaner strikt ab (Papst Paul III. hatte sie 1537 verboten). Die Mönche nahmen Tisquantum auf, pflegten ihn und ließen ihn für ihren Orden arbeiten. Drei Jahre später überzeugte er seine Retter, ihn ziehen zu lassen – und schaffte es irgendwie nach England. Und irgendwie nach London.
Dort kam er bei John Slaney unter. Der einflussreiche Kaufmann war einer der Big Player in der Londoner Geschäftswelt zu Beginn des 17. Jahrhunderts; als Treasurer der Newfoundland Company kümmerte er sich um die koloniale Besiedlung Neufundlands. Man kann davon ausgehen, dass er Tisquantum nicht nur bei sich wohnen ließ, um ihn als exotischen Überraschungsgast bei Geschäftsessen zu präsentieren – für Slaney war der Patuxet eine Figur im großen Schachspiel um die Reichtümer der Neuen Welt. Nach drei Jahren schickte er seinen nun zweisprachigen Gast über den Atlantik. Tisquantum war zurück in Amerika. In einem englischen Fischercamp in Neufundland allerdings, 1600 Kilometer entfernt von seiner Heimat.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 169. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Stefan Nink, Jahrgang 1965, findet, dass es gerade nun an der Zeit sei, kleine Geschichten der USA zu erzählen, mit denen man die große besser versteht.
Der US-Illustrator Peter Burchard (1921–2004) war zunächst Kriegszeichner, später wandte er sich der Bebilderung von Kinderbüchern zu.
| Lieferstatus | Lieferbar |
|---|---|
| Vita | Stefan Nink, Jahrgang 1965, findet, dass es gerade nun an der Zeit sei, kleine Geschichten der USA zu erzählen, mit denen man die große besser versteht. Der US-Illustrator Peter Burchard (1921–2004) war zunächst Kriegszeichner, später wandte er sich der Bebilderung von Kinderbüchern zu. |
| Person | Von Stefan Nink und Peter Burchard |
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Vita | Stefan Nink, Jahrgang 1965, findet, dass es gerade nun an der Zeit sei, kleine Geschichten der USA zu erzählen, mit denen man die große besser versteht. Der US-Illustrator Peter Burchard (1921–2004) war zunächst Kriegszeichner, später wandte er sich der Bebilderung von Kinderbüchern zu. |
| Person | Von Stefan Nink und Peter Burchard |