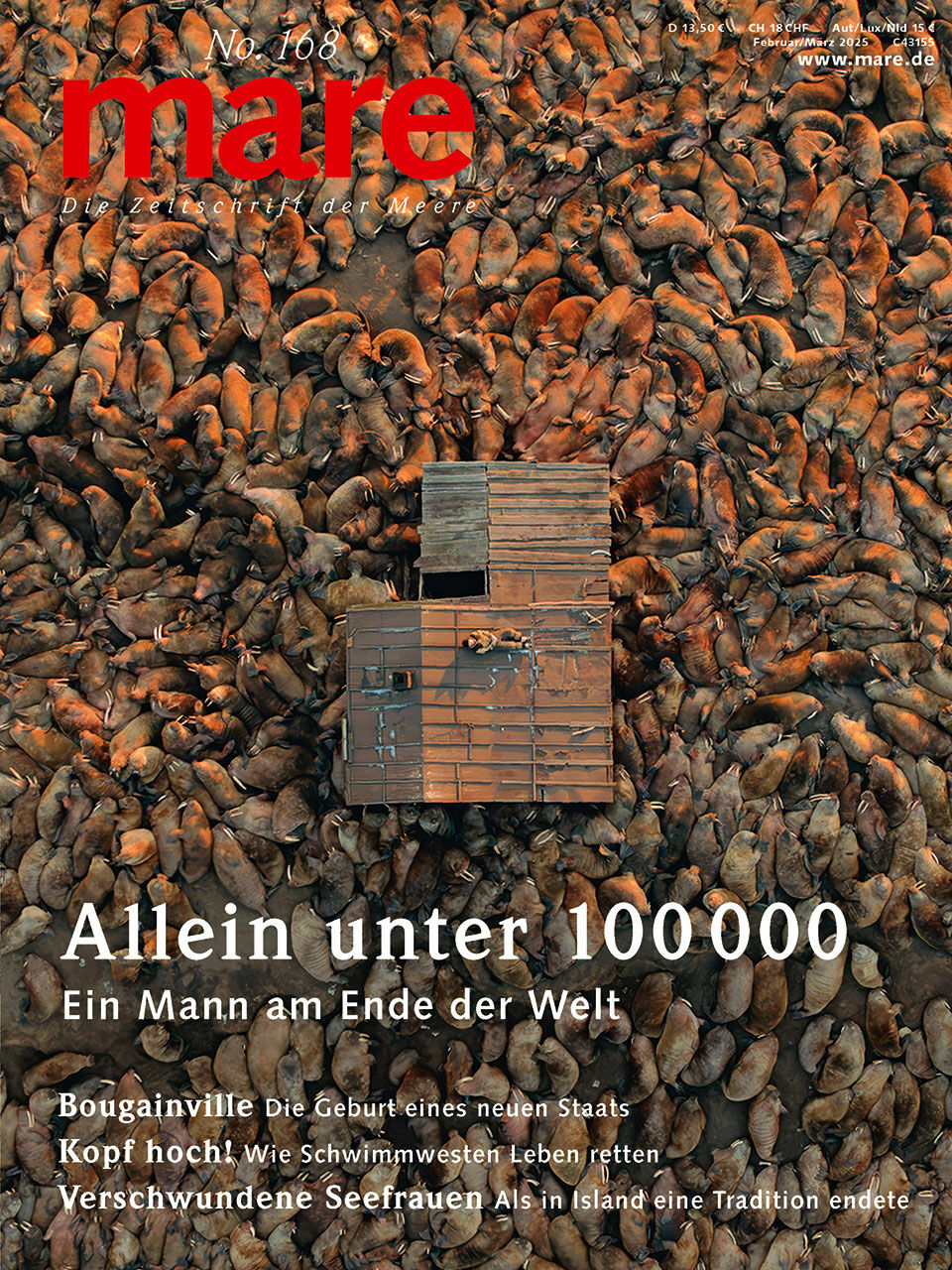Das Recht der Meere
Es war der 28. Oktober 1997, ein Dienstag, als der unter der Flagge von St. Vincent und den Grenadinen fahrende Öltanker MS „Saiga“ vor der westafrikanischen Küste von der Marine Guineas gestoppt wurde. Einen Tag zuvor hatten Zollbeamte durch Abhören des Funks mitbekommen, dass das Schiff einige Fischerboote in den Hoheitsgewässern des Landes mit Treibstoff versorgt hatte – ein Geschäftsmodell, das Ende der 1990er auf den Weltmeeren nur so blühte, oft unter Verletzung nationaler Steuergesetze. Beim anschließenden Aufbringen wurden zwei Besatzungsmitglieder der „Saiga“ durch Schusswaffen verletzt, dazu entstand erheblicher Sachschaden, bevor der Tanker im Hafen von Conakry festgesetzt wurde. In die breite Öffentlichkeit gelangten die Geschehnisse nicht – dabei schrieben sie Geschichte, weil sie zum ersten Fall vor dem Internationalen Seegerichtshof in Hamburg wurden, dem offiziellen Streitbeilegungsorgan des Seerechtsübereinkommens der Vereinten Nationen.
Das UN-Seerechtsübereinkommen (SRÜ) wurde am 10. Dezember 1982 in Montego Bay auf Jamaika geschlossen.
Es bildet das zentrale Regelwerk des Seevölkerrechts, eines der ältesten Gebiete des allgemeinen Völkerrechts, in dem bestimmte Maximen wie die Freiheit der Hohen See oder die Pflicht zur Hilfeleistung bei Seenot bereits seit Jahrhunderten existieren. Umfangreiche seerechtliche Kodifikationen gab es erstmals in der Hansezeit, weltweite Abkommen fanden sich bis Mitte des 20. Jahrhunderts indes nur selten.
Mehrere Entwicklungen bedingten dann jedoch einen Handlungsbedarf: Seit geraumer Zeit dehnten viele Staaten ihr Küstenmeer aus, in dem vollständige Ho- heitsgewalt wie an Land ausgeübt wird; dieses betrug vorher meist drei, nun aber bis zu zwölf Seemeilen, was vermehrt zu Konflikten führte. Die USA und andere Länder stellten nach dem Zweiten Weltkrieg zudem ihren Kontinentalschelf unter nationales Recht und erweiterten so ebenfalls ihre Hoheitsgewässer. In den 1960ern verlagerten darüber hinaus diverse Förderländer und Konzerne den Öl- und Rohstoffabbau ins Meer, was das Bewusstsein für die Schädigung der Ozeane verstärkte. Prägende Figuren wurden in diesem Zusammenhang zum einen der maltesische Botschafter Arvid Pardo (1914–1999), der 1967 in einer flammenden Rede vor der UN-Generalversammlung internationale Regeln für die Bewahrung und den Schutz der Meere forderte und diese zum Teil des „gemeinsamen Erbes der Menschheit“ erklärte. Maßgeblich war ebenso Elisabeth Mann Borgese (1918–2002), die von einer Aktivistin für die Ozeane zu deren passioniertester Botschafterin wurde und entscheidend dazu beitrug, dass ein einheitliches Seerecht entstehen konnte.
Von 1956 bis 1958 und 1960 fanden die erste und die zweite Seerechtskonferenz bei den Vereinten Nationen statt (UNCLOS I und II), in denen gleichwohl nur einzelne Probleme gelöst werden konnten. Im Jahr 1973 begann die dritte Konferenz (UNCLOS III), die zur bis dahin größten und längsten in der Geschichte der UN werden sollte. Nachdem das SRÜ schließlich Ende 1982 verabschiedet wurde, trat es am 16. November 1994 in Kraft, wie vorgesehen ein Jahr nach Hinterlegung der 60. Ratifikationsurkunde. Der singapurische Diplomat Tommy Koh, der die Konferenz leitete, nannte es die „Verfassung der Meere“, weil es nahezu jeden Aspekt der Meeresnutzung thematisiert.
Der Grundgedanke der Konvention ist die gleichberechtigte Teilhabe und Kooperation aller Staaten, auch der Entwicklungs- und Schwellenländer. Dies kommt schon in der Präambel zum Ausdruck, nach der das SRÜ „von dem Bestreben geleitet ist, alle das Seerecht betreffenden Fragen im Geiste gegenseitiger Verständigung und Zusammenarbeit zu regeln“.
In seinen ersten Abschnitten schreibt das Übereinkommen zunächst Grundprinzipien des Seevölkerrechts fest, etwa das Recht der friedlichen Durchfahrt oder die Geltung der Strafgerichtsbarkeit des Flaggenstaats an Bord.
Den Schwerpunkt bildet sodann die abgestufte Zuordnung des Meeres zum Hoheitsgebiet der Küstenstaaten: Die vorher umstrittene Breite des Küstenmeers wurde auf maximal zwölf Seemeilen begrenzt, Sonderregeln gelten für Meerengen, die geografisch oder für den Welthandel sensibel sind, beispielsweise die Straße von Gibraltar. Innerhalb einer Anschlusszone von weiteren zwölf, also insgesamt 24, Seemeilen haben Küstenstaaten das Recht, gegenüber fremden Schiffen aktiv zu werden, um Zoll-, Gesundheits- und Einreisevorschriften durchzusetzen oder im Hoheitsgebiet begangene Rechtsverstöße zu verfolgen. Hieran schließt die „Ausschließliche Wirtschaftszone“ von bis zu 200 Seemeilen mit exklusiven Rechten an lebenden und nicht lebenden Ressourcen an, in der Hoheitsbefugnisse nur noch marginal bestehen. Keine Vorschriften enthält das SRÜ für potenzielle Überlappungen, die daher zwischen den Staaten einvernehmlich gelöst werden müssen; gerade die Mittelmeeranrainer waren infolgedessen bei der Einrichtung von Ausschließlichen Wirtschaftszonen bisher sehr zurückhaltend, weltweit sind heute dennoch circa 40 Prozent der Meeresgebiete als solche deklariert.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 168. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Stephan Sura, Jahrgang 1986, ist freier Autor aus Köln. Während seines Jurastudiums in Köln und Kopenhagen kam er nicht mit dem Seerecht in Kontakt – leider, wie sich bei der Arbeit für diesen Beitrag herausstellte. Ein wirklich interessantes Gebiet.
| Vita | Stephan Sura, Jahrgang 1986, ist freier Autor aus Köln. Während seines Jurastudiums in Köln und Kopenhagen kam er nicht mit dem Seerecht in Kontakt – leider, wie sich bei der Arbeit für diesen Beitrag herausstellte. Ein wirklich interessantes Gebiet. |
|---|---|
| Person | Von Stephan Sura |
| Vita | Stephan Sura, Jahrgang 1986, ist freier Autor aus Köln. Während seines Jurastudiums in Köln und Kopenhagen kam er nicht mit dem Seerecht in Kontakt – leider, wie sich bei der Arbeit für diesen Beitrag herausstellte. Ein wirklich interessantes Gebiet. |
| Person | Von Stephan Sura |