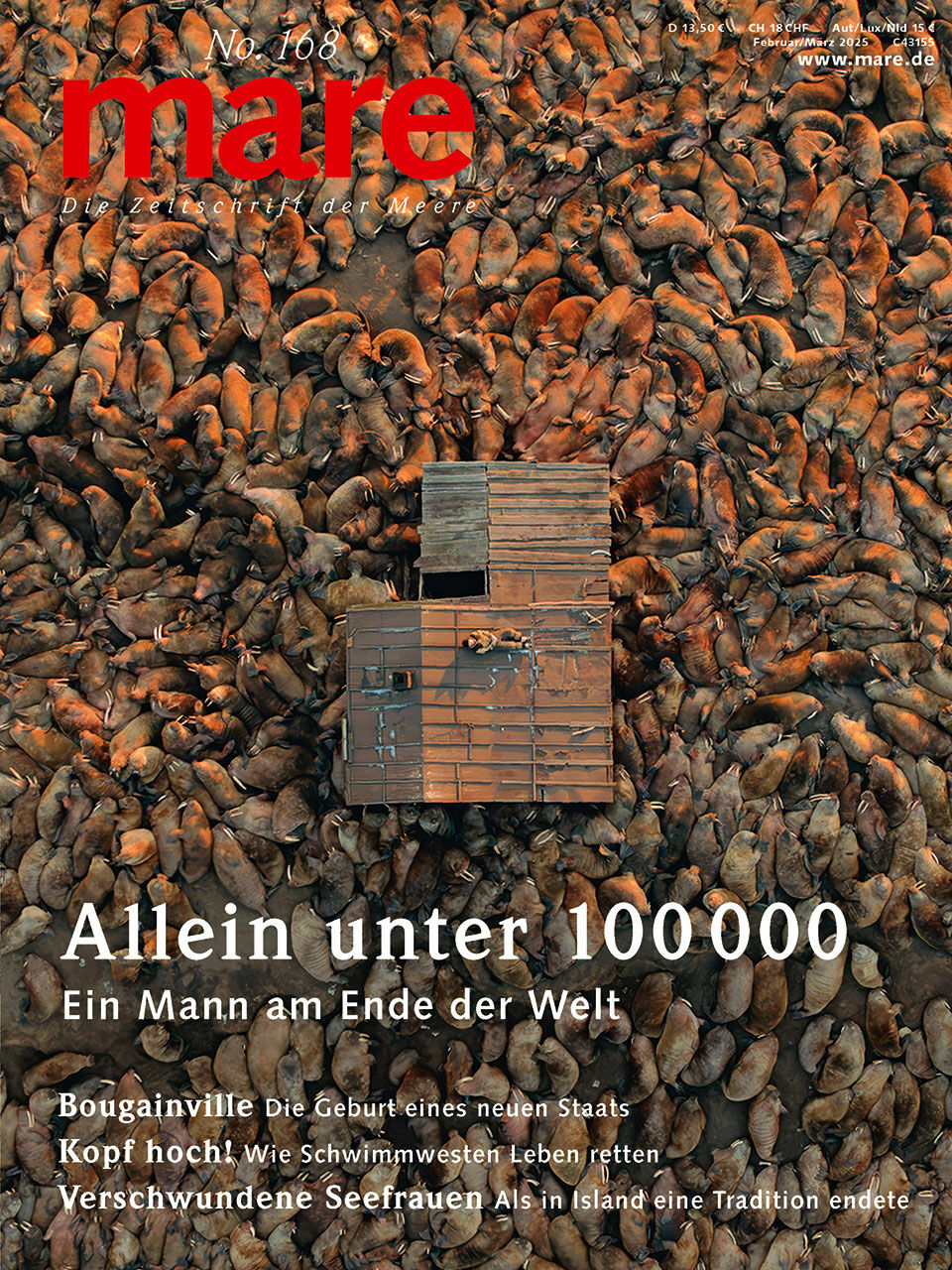Das Meer der intimen Nähe
Im Winter findet man auch an der nördlichen Adria noch stille Orte, Orte voller Erzählungen, voller Geschichten. Etwa im Grenzland zwischen Italien, Slowenien und Kroatien, einer Gegend, in der Grenzen fließend werden, in der die Möglichkeit zu erahnen ist, wie ein Miteinander jenseits des Nationalen sein könnte. Der 2017 verstorbene kroatische Schriftsteller Predrag Matvejevi´c, der große Vermittler zwischen den Kulturen des adriatischen Raums, hat die Adria in seinen 1987 erschienenen Buch „Der Mediterran“ daher auch als „Meer der intimen Nähe“ beschrieben.
Doch diese Nähe als Möglichkeit, wie sie der Autor, Übersetzer und überzeugte Mitteleuropäer Claudio Magris am Beispiel von Triest skizziert, die Nähe als Gelegenheit, „den vielschichtigen und vermischten Charakter einer jeden Identität zu entdecken“, diese adriatische Nähe verschiedenster Kulturen, dieses verbindende, vermischende Element des Meeres, der Schifffahrt, der Wellen, Wolken und Winde – dies alles müssen wir seit einigen Dekaden in einem anderen Licht betrachten.
Denn aus der intimen Nähe der Adria, aus dem Miteinander fluider Kulturen ist an vielen Orten Gedränge, aufgeregte Instagram-Gegenwart geworden. Es ist eng, Dichtestress herrscht in vielen Städten der Adria, vor allem im Sommer. Es gilt schon lange nicht mehr das Primat der Serenissima, der heiteren Unbeschwerten, das die Adria dominiert. Stattdessen finden wir hier, wie der Historiker Aleksandar Jakir festgestellt hat, eine Dominanz des Massentourismus, die in ihrer Totalität alles Gewesene in den Schatten stellt. In keinem Jahrhundert zuvor, schreibt er, war diese Herrschaft über die Adria so total wie heute.
Auf engem Raum, in diesem verhältnismäßig kleinen Nebenmeer des Mittelmeers, ertrinken Menschen auf der Flucht in den Fluten, während die Zahl derer, die die adriatischen Länder bereisen, immer mehr werden. Im Zentrum des Massentourismus stehen Italien, Slowenien und Kroatien, doch neue touristische Hotspots könnten schon bald Montenegro und Albanien werden. Die Zersiedelung der Küste schreitet auch dort scheinbar unaufhaltsam voran, mit fatalen ökologischen Kollateralschäden.
Im 25. April des letzten Jahres beschloss die Lagunenstadt Venedig, für den Einlass in die Stadt eine Gebühr zu verlangen. Seither kostet es Tagesgäste fünf Euro, die Stadt zu besuchen, von kommendem 18. April an gar zehn Euro. Die Einführung eines Eintrittsgelds möge Menschen von dem Besuch der Stadt abhalten, sagt der Bürgermeister von Venedig, Luigi Brugnaro. „Erstes Ziel ist es, die Stadt zu schützen und wieder lebenswert zu machen.“ Doch ob solche Maßnahmen helfen werden? Das eingenommene Geld soll dafür verwendet werden, Kanäle, Straßen und Gebäude zu sanieren. Zuvor hatte die Unesco bereits davor gewarnt, Venedig auf die Rote Liste des „bedrohten Weltkulturerbes“ zu setzen.
Eine ähnliche Gebühr wird auch im dalmatinischen Dubrovnik diskutiert, dem Drehort der TV-Erfolgsserie „Game of Thrones“, mit 1,2 Millionen Besuchern im Jahr 2023 – verglichen mit der italienischen Lagunenstadt ist das noch wenig, denn dort waren es im vergangenen Jahr 20 Millionen.
In vielen Adriaregionen ist der Tourismus längst die Haupteinnahmequelle. Das gilt besonders für Kroatien, aber auch für die italienischen Strände der oberen Adria. In Rimini, der Geburtsstadt des Regisseurs Federico Fellini, begann der adriatische Tourismus. 1843 wurden hier eine erste Badeanstalt und das erste Grandhotel der Adria eröffnet. Rimini avancierte zu einem Lieblingsort des Adels und der High Society. In den 1960er-Jahren – 1960 kam Fellinis Film „La dolce vita“ in die Kinos – wurde der Ort zum Sehnsuchtsziel einer neuen Generation von Reisenden, die hier, an dem 15 Kilometer langen Sandstrand, nach einem Mythos suchten, nach der Idee des Dolce Vita, nach Müßiggang und Leichtigkeit. Schon damals besuchten 500 000 Urlauber jährlich das Seebad. Immer breitere Gesellschaftsschichten strömten, vor allem aus Westdeutschland, herbei, die in Italien nicht länger Erbauung bei der in der Bildungsbourgeosie beinahe obligatorischen „Grand Tour“, sondern Sonne und Sandstrand fanden. Heute gibt es in Rimini nahezu 1200 Hotels und Pensionen.
Als Leonardo da Vinci 1502 seinen Hafenkanal von Cesenatico entwarf, nur wenige Kilometer nördlich von Rimini, war der Stern Venedigs bereits am Verglühen. Nach dem Fall Konstantinopels wurde die Serenissima durch das Osmanische Reich aus dem östlichen Mittelmeer verdrängt. Auch wenn es seit dem frühen 15. Jahrhundert noch einmal gelang, die Macht auf die „terraferma“ auszudehnen – der Herrschaftsanspruch bröckelte. Spätestens im 17. Jahrhundert war von der Weltmacht nicht mehr viel übrig.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 168. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Marc Peschke, 1970 geboren, Kunsthistoriker, Journalist und Künstler, lebt in Wertheim am Main, Wiesbaden und Hamburg. Er schreibt über Kunst und Musik und arbeitet als freier Kurator. Seit 2008 zeigen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sein künstlerisches Werk. Zuletzt schrieb er in mare No. 162 einen Essay über „Musik, Freiheit, Entgrenzung und das Meer“.
| Vita | Marc Peschke, 1970 geboren, Kunsthistoriker, Journalist und Künstler, lebt in Wertheim am Main, Wiesbaden und Hamburg. Er schreibt über Kunst und Musik und arbeitet als freier Kurator. Seit 2008 zeigen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sein künstlerisches Werk. Zuletzt schrieb er in mare No. 162 einen Essay über „Musik, Freiheit, Entgrenzung und das Meer“. |
|---|---|
| Person | Von Marc Peschke |
| Vita | Marc Peschke, 1970 geboren, Kunsthistoriker, Journalist und Künstler, lebt in Wertheim am Main, Wiesbaden und Hamburg. Er schreibt über Kunst und Musik und arbeitet als freier Kurator. Seit 2008 zeigen zahlreiche Ausstellungen im In- und Ausland sein künstlerisches Werk. Zuletzt schrieb er in mare No. 162 einen Essay über „Musik, Freiheit, Entgrenzung und das Meer“. |
| Person | Von Marc Peschke |