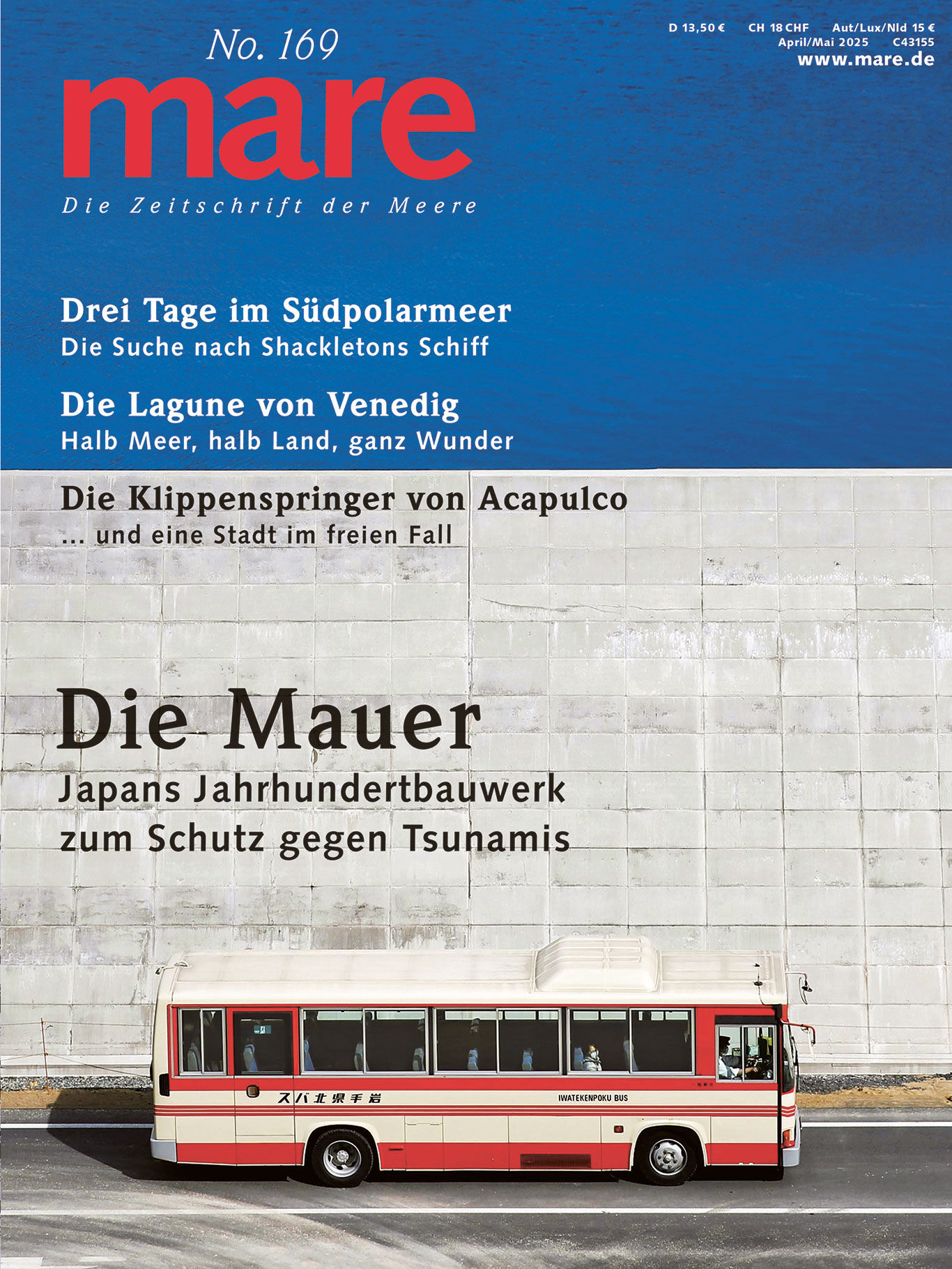Braunschweig liegt am Meer
Das Meer ist auch dann bereits spürbar, wenn es nie erreicht wird. Den Geruch, das Salz der Brandung, die Weite des Horizonts, all das glaubten Besucher der „Jaws“-Attraktion (deutsch „Der weiße Hai“) der Universal Studios in Hollywood zu erleben, als sie mit einem kleinen Kutter auf Ozeantour gingen. Und während ein Leuchtturm, Bootshäuser, unübersichtliche Landzungen und Fischerhäuser vorbeizogen, merkte niemand, dass die Tour in Wahrheit im Kreis ging. Das Meer schien hinter jeder Landzunge zu warten, auch wenn es in dieser Freizeitparkattraktion nie erreicht wurde.
Wie sehr wir gerade in der Abwesenheit des Meeres maritim zu träumen beginnen, weiß jeder, der als Wassersportler, der landlocked ist, einmal einen der zahlreichen Baggerseen besucht hat, die abseits der Küsten im Sommer das versprechen, was kein Binnenland bieten kann: den Traum vom Glück am Strand. Da werben Strandbars mit klangvollen Namen wie „Jim’s Beach Bar“, „Caribic Beach“ oder „Okercabana“ um abenteuerlustige Besucher. Da wird viel feiner weißer Sand in die Natur gekippt, auf dem die Gäste barfuß in Liegestühlen sitzen können. Drinks wie „Sex on the beach“ und eher ortsfremde Gerichte wie frisch gegrillte Black-Tiger-Garnelen erzählen vom Glück an den Stränden in unmittelbarer Nähe von Städten wie Castrop-Rauxel, Salzgitter oder wie immer sie heißen.
Der Grund dafür, dass wir weit entfernt von jeder Küste die Brandung rauschen hören, liegt in der Besonderheit der menschlichen Natur, Leerstellen auszufüllen – und zwar mit dem gewünschten Inhalt. Ein kollektiver Traum kann so zur partiellen Realität werden. Und der Traum vom Strand wird ganz offensichtlich größer, je weiter wir davon realiter entfernt sind. „Braunschweig liegt am Meer“ überschrieb einst eine neu beginnende Theaterdirektion ihre erste Spielzeit. Stündlich erklang ein Nebelhorn über dem Großen Haus, weit entfernt von jeder Küste in der niedersächsischen Tiefebene. Und das Experiment glückte. Der Klang des Hamburger Hafens ließ auch die mittelgroße Binnenstadt ein wenig maritimer erscheinen, weil die erstaunten Autofahrer und Theaterbesucher das Geräusch zuverlässig zuordnen konnten, obwohl es gerade nicht zu ihrem Alltag gehörte.
Das Hollywoodkino hat dieses Phänomen bereits mit der Einführung des Tonfilms in den 1930er-Jahren entdeckt, als sich erstmals die Frage stellte, welche Soundkulisse für eine bestimmte Szene einem Publikum überhaupt zugemutet werden kann, ohne die eigentliche Handlung zu vernachlässigen. Schnell bemerkten die ersten Sounddesigner der Filmgeschichte, dass das Meer eben nicht dauerhaft rauschen muss, um im Geist der Kinobesucher anwesend zu sein. Schon das Geräusch einer einzigen, brechenden Welle oder eben eines Nebelhorns reicht aus, um uns an einen anderen Ort zu versetzen. Der Hörsinn reagiert ganz offenbar auf neu hinzukommende Geräusche, um dann den einmal identifizierten Klang irgendwann auszublenden, wie es jeder Mensch am Strand schon einmal bemerkt hat: Hören wir anfangs begeistert dem Rauschen zu, umgibt es uns nach einiger Zeit als nicht mehr aktiv hörbare Klangwelt. Auch das ikonische Kreischen der Möwen nehmen wir schnell nicht mehr aktiv wahr. Erst wenn die Meeresvögel verschwinden, bemerkt unser auf Veränderung trainierter Hörsinn, dass etwas fehlt. Hören wir später dieselben Klänge irgendwo im Ruhrgebiet, ergänzt unsere Fantasie dankbar das, was fehlt.
Was für Geräusche gilt, lässt sich auch auf Bilder und die Gestaltung von Orten übertragen. Wir bewerten Räume anhand von Indizien. Nicht nur auf einer Theaterbühne reichen deshalb bereits Versatzstücke aus, um uns kraft unserer Fantasie zuverlässig an einen anderen Ort dieser Welt zu versetzen. Eine Palme kann auf diese Weise ein Indiz sein, der gerade in Deutschland so beliebte Strandkorb oder einfach nur das beruhigende Gefühl von Sand zwischen unseren Zehen, wie schon die Beach Boys wussten. Die Mitglieder der legendären Band, die für alle Ewigkeit den Klang zum mythisch verklärten kalifornischen Surfertraum lieferten, konnten sich selbst allenfalls kurz auf dem Surfbrett halten. Sie sangen ihre Songs auch nicht auf einer „Beach Boys’ Party!“ (wie eine ihrer Platten tatsächlich hieß). Um das Gefühl des Meeres bei der Aufnahme im Studio trotzdem zu spüren, ließen die Musiker kurzerhand Sand zwischen den Mikrofonständern auskippen, an denen die Bandmitglieder dann barfuß Hits wie „Fun, Fun, Fun“ oder „Wouldn’t It Be Nice“ einsangen. Eine Maßnahme, die anscheinend eine erstaunliche Wirkung erzielte, wenigstens, wenn man den riesigen Erfolg dieses Inbegriffs der Strandmusik auf den Moment ihrer Entstehung zurückführen möchte. Die Songs entführen noch heute immer neue Generationen überall auf der Welt zurück an einen Strandtag im Kalifornien der 1960er-Jahre, den es so nie gegeben hat.
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 169. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bedauert es, dass ihn sein Berufsweg bisher noch nicht an eines der wenigen Theater in der Nähe des Meeres geführt hat. Der promovierte Medienwissenschaftler und Historiker arbeitet als Dramaturg, Theaterleiter und Autor und schreibt unter anderem regelmäßig Essays für mare.
| Lieferstatus | Lieferbar |
|---|---|
| Vita | Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bedauert es, dass ihn sein Berufsweg bisher noch nicht an eines der wenigen Theater in der Nähe des Meeres geführt hat. Der promovierte Medienwissenschaftler und Historiker arbeitet als Dramaturg, Theaterleiter und Autor und schreibt unter anderem regelmäßig Essays für mare. |
| Person | Von Alexander Kohlmann |
| Lieferstatus | Lieferbar |
| Vita | Alexander Kohlmann, Jahrgang 1978, bedauert es, dass ihn sein Berufsweg bisher noch nicht an eines der wenigen Theater in der Nähe des Meeres geführt hat. Der promovierte Medienwissenschaftler und Historiker arbeitet als Dramaturg, Theaterleiter und Autor und schreibt unter anderem regelmäßig Essays für mare. |
| Person | Von Alexander Kohlmann |