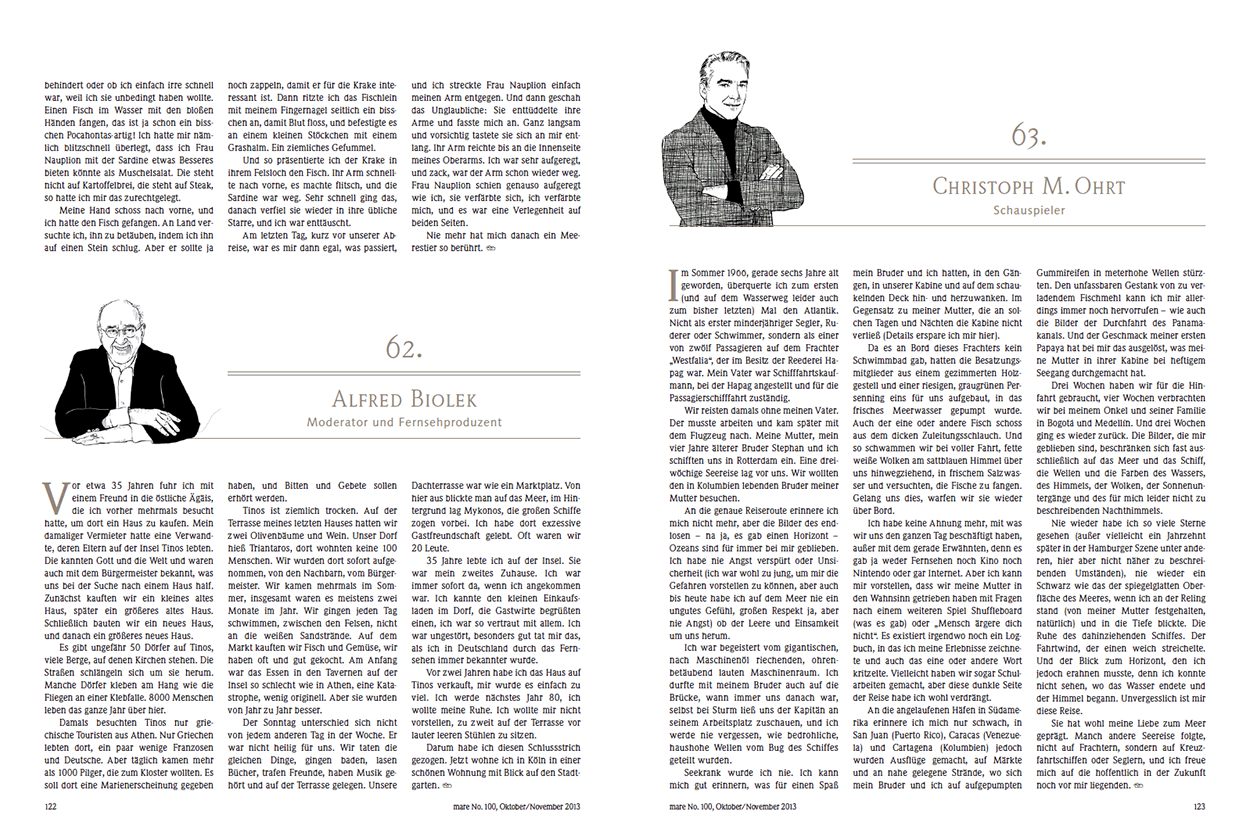Alfred Biolek, Christoph M. Ohrt, Götz Werner, Christine Westermann, Markus Lanz, Rüdiger Nehberg
ALFRED BIOLEK
Moderator und Fernsehproduzent
Vor etwa 35 Jahren fuhr ich mit einem Freund in die östliche Ägäis, die ich vorher mehrmals besucht hatte, um dort ein Haus zu kaufen. Mein damaliger Vermieter hatte eine Verwandte, deren Eltern auf der Insel Tinos lebten. Die kannten Gott und die Welt und waren auch mit dem Bürgermeister bekannt, was uns bei der Suche nach einem Haus half. Zunächst kauften wir ein kleines altes Haus, später ein größeres altes Haus. Schließlich bauten wir ein neues Haus, und danach ein größeres neues Haus.
Es gibt ungefähr 50 Dörfer auf Tinos, viele Berge, auf denen Kirchen stehen. Die Straßen schlängeln sich um sie herum. Manche Dörfer kleben am Hang wie die Fliegen an einer Klebfalle. 8000 Menschen leben das ganze Jahr über hier.
Damals besuchten Tinos nur griechische Touristen aus Athen. Nur Griechen lebten dort, ein paar wenige Franzosen und Deutsche. Aber täglich kamen mehr als 1000 Pilger, die zum Kloster wollten. Es soll dort eine Marienerscheinung gegeben haben, und Bitten und Gebete sollen erhört werden.
Tinos ist ziemlich trocken. Auf der Terrasse meines letzten Hauses hatten wir zwei Olivenbäume und Wein. Unser Dorf hieß Triantaros, dort wohnten keine 100 Menschen. Wir wurden dort sofort aufgenommen, von den Nachbarn, vom Bürgermeister. Wir kamen mehrmals im Sommer, insgesamt waren es meistens zwei Monate im Jahr. Wir gingen jeden Tag schwimmen, zwischen den Felsen, nicht an die weißen Sandstrände. Auf dem Markt kauften wir Fisch und Gemüse, wir haben oft und gut gekocht. Am Anfang war das Essen in den Tavernen auf der Insel so schlecht wie in Athen, eine Katastrophe, wenig originell. Aber sie wurden von Jahr zu Jahr besser.
Der Sonntag unterschied sich nicht von jedem anderen Tag in der Woche. Er war nicht heilig für uns. Wir taten die gleichen Dinge, gingen baden, lasen Bücher, trafen Freunde, haben Musik gehört und auf der Terrasse gelegen. Unsere Dachterrasse war wie ein Marktplatz. Von hier aus blickte man auf das Meer, im Hintergrund lag Mykonos, die großen Schiffe zogen vorbei. Ich habe dort exzessive Gastfreundschaft gelebt. Oft waren wir 20 Leute.
35 Jahre lebte ich auf der Insel. Sie war mein zweites Zuhause. Ich war immer sofort da, wenn ich angekommen war. Ich kannte den kleinen Einkaufsladen im Dorf, die Gastwirte begrüßten einen, ich war so vertraut mit allem. Ich war ungestört, besonders gut tat mir das, als ich in Deutschland durch das Fernsehen immer bekannter wurde.
Vor zwei Jahren habe ich das Haus auf Tinos verkauft, mir wurde es einfach zu viel. Ich werde nächstes Jahr 80, ich wollte meine Ruhe. Ich wollte mir nicht vorstellen, zu zweit auf der Terrasse vor lauter leeren Stühlen zu sitzen.
Darum habe ich diesen Schlussstrich gezogen. Jetzt wohne ich in Köln in einer schönen Wohnung mit Blick auf den Stadtgarten.
CHRISTOPH M. OHRT
Schauspieler
Im Sommer 1966, gerade sechs Jahre alt geworden, überquerte ich zum ersten (und auf dem Wasserweg leider auch zum bisher letzten) Mal den Atlantik. Nicht als erster minderjähriger Segler, Ruderer oder Schwimmer, sondern als einer von zwölf Passagieren auf dem Frachter „Westfalia“, der im Besitz der Reederei Hapag war. Mein Vater war Schifffahrtskaufmann, bei der Hapag angestellt und für die Passagierschifffahrt zuständig.
Wir reisten damals ohne meinen Vater. Der musste arbeiten und kam später mit dem Flugzeug nach. Meine Mutter, mein vier Jahre älterer Bruder Stephan und ich schifften uns in Rotterdam ein. Eine dreiwöchige Seereise lag vor uns. Wir wollten den in Kolumbien lebenden Bruder meiner Mutter besuchen.
An die genaue Reiseroute erinnere ich mich nicht mehr, aber die Bilder des endlosen – na ja, es gab einen Horizont – Ozeans sind für immer bei mir geblieben. Ich habe nie Angst verspürt oder Unsicherheit (ich war wohl zu jung, um mir die Gefahren vorstellen zu können, aber auch bis heute habe ich auf dem Meer nie ein ungutes Gefühl, großen Respekt ja, aber nie Angst) ob der Leere und Einsamkeit um uns herum.
Ich war begeistert vom gigantischen, nach Maschinenöl riechenden, ohrenbetäubend lauten Maschinenraum. Ich durfte mit meinem Bruder auch auf die Brücke, wann immer uns danach war, selbst bei Sturm ließ uns der Kapitän an seinem Arbeitsplatz zuschauen, und ich werde nie vergessen, wie bedrohliche, haushohe Wellen vom Bug des Schiffes geteilt wurden.
Seekrank wurde ich nie. Ich kann mich gut erinnern, was für einen Spaß mein Bruder und ich hatten, in den Gängen, in unserer Kabine und auf dem schaukelnden Deck hin- und herzuwanken. Im Gegensatz zu meiner Mutter, die an solchen Tagen und Nächten die Kabine nicht verließ (Details erspare ich mir hier).
Da es an Bord dieses Frachters kein Schwimmbad gab, hatten die Besatzungsmitglieder aus einem gezimmerten Holzgestell und einer riesigen, graugrünen Persenning eins für uns aufgebaut, in das frisches Meerwasser gepumpt wurde. Auch der eine oder andere Fisch schoss aus dem dicken Zuleitungsschlauch. Und so schwammen wir bei voller Fahrt, fette weiße Wolken am sattblauen Himmel über uns hinwegziehend, in frischem Salzwasser und versuchten, die Fische zu fangen. Gelang uns dies, warfen wir sie wieder über Bord.
...
Dies ist ein Auszug aus dem Text. Den ganzen Beitrag lesen Sie in mare No. 100. Abonnentinnen und Abonnenten lesen ihn auch hier im mare Archiv.
| Vita | Die Angaben zu den Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |
|---|---|
| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |
| Vita | Die Angaben zu den Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |
| Person | Die Texte der Autorinnen und Autoren sind aus dem Jahr 2013. |